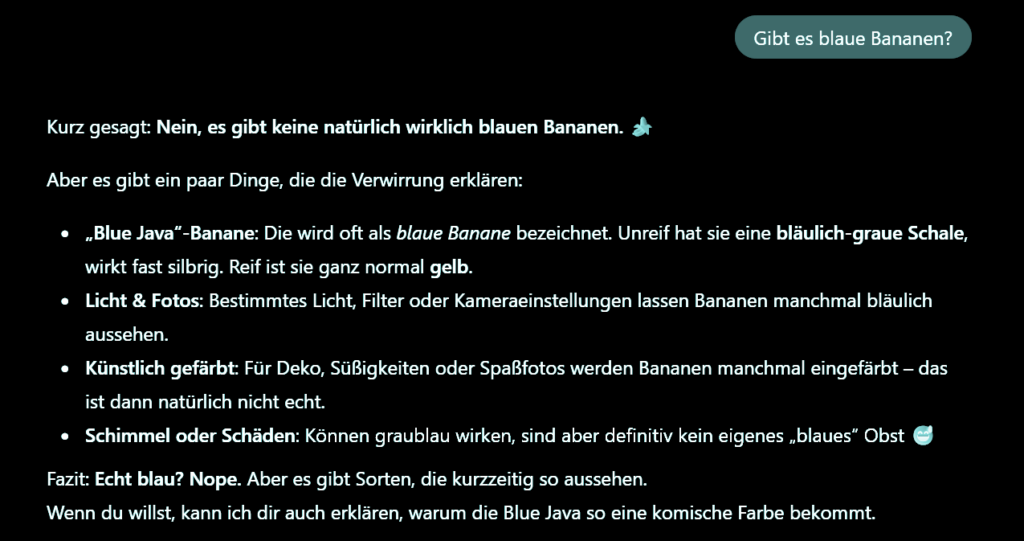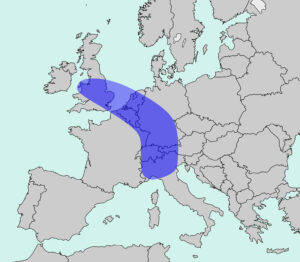Rufina Cambaceres (auch Cambacérès geschrieben) (* 31. Mai 1883; † 31. Mai 1902) stammte aus einer wohlhabende Familie. Ihr Vater war der argentinische Schriftsteller und Politiker Eugenio Cambaceres, ihre Mutter die italienische Tänzerin Luisa Bacichi, die er 1887 in Paris heiratete. Sie trat das alleinige Erbe eines großen Vermögens aus der argentinischen Viehzucht an.
1902 wurde sie im Alter von 19 Jahren scheinbar leblos aufgefunden. Sie wurde in der Familiengruft in Buenos Aires beigesetzt. Nach ihrer Beerdigung wurden Geräusche aus dem Grab vernommen. Es stellte sich heraus, dass sie lebendig begraben worden war.
Cambaceres wurde als „das Mädchen, das zweimal starb“ bekannt. Entsprechend ist Grab eines der bekanntesten auf dem Friedhof La Recoleta.
Leben und Tod
Cambaceres’ Vater starb an Tuberkulose, als sie vier Jahre alt war. Cambaceres genoss eine gute Ausbildung, war eine exzellente Schülerin, die fünf Sprachen beherrschte. Sie wurde zu einer Prominenten in Buenos Aires.
Am Abend ihres 19. Geburtstags brach Cambaceres leblos zusammen, als sie dabei war, sich für die Oper umzuziehen. Drei Ärzte stellten ihren Tod fest, die Todesursache wurde als Schlaganfall oder Herzinfarkt angegeben.
Am Tag darauf wurde sie von ihrer Mutter, mit ihrem Lieblingsschmuck bekleidet, im Familienmausoleum beigesetzt. Noch in der gleichen Nacht hörte der Wächter tiefe, laute Geräusche aus ihrer Gruft. Aus Sorge, Diebe könnten die Leiche plündern, ging er zur Gruft und stellte fest, dass sich der Sarg bewegt hatte und der Deckel teilweise zerbrochen war. Nach genauerer Überprüfung entdeckte er Kratzspuren an der Innenseite des Deckels und im Gesicht der jungen Frau, ein untrügliches Zeichen dafür, dass Cambaceres lebendig begraben worden war.
Mögliche Gründe für Cambaceres’ Zusammenbruch und Tod

Als Ursache für Cambaceres’ ursprünglichen Zusammenbruch wird Katalepsie (Starrsucht) angenommen, für die keine Ursache bekannt ist. Nachdem die junge Frau in ihrem Grab aufgewacht war, ist sie sowohl an Erstickung, Erschöpfung oder Schock gestorben. Es ist auch eine andere, aber unwahrscheinliche Ursache im Umlauf, nach der ihre Leiche neben der Türe gefunden worden sei. Sie hätte es also geschafft, den Sarg zu verlassen. Nachdem sie mitten in der Nacht festgestellt hatte, dass sie in dem Mausoleum gefangen war, soll sie einen Herzinfarkt erlitten haben.
Der tragische Vorfall hatte Konsequenzen. Es wurden Glockenspiele in Särgen installiert, für den Fall, dass für tot Geglaubte erwachten.

Grab von Cambaceres
Das Grab ist ein Jugendstil-Meisterwerk und soll von der Mutter beauftragt worden sein. Es besteht aus Carrara-Marmor und zeigt eine lebensgroße Statue Cambaceres’, wie sie die Tür ezu ihrem eigenen Mausoleum berührt und es offenkundig verlassen will.
Oben findet sich eine geschnitzte Rose, daneben ein geschnitztes Bett, in dem ihre Mutter schlafen und ihr Gesellschaft leisten konnte. Das Grab Cambaceres’ ist eines der meistbesuchten Gräber auf dem Friedhof.
Eine weitere Großstadtlegende besagt, dass ihr Geist auf dem Friedhof spukt.